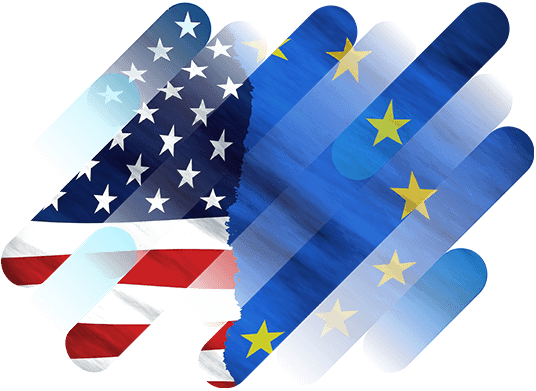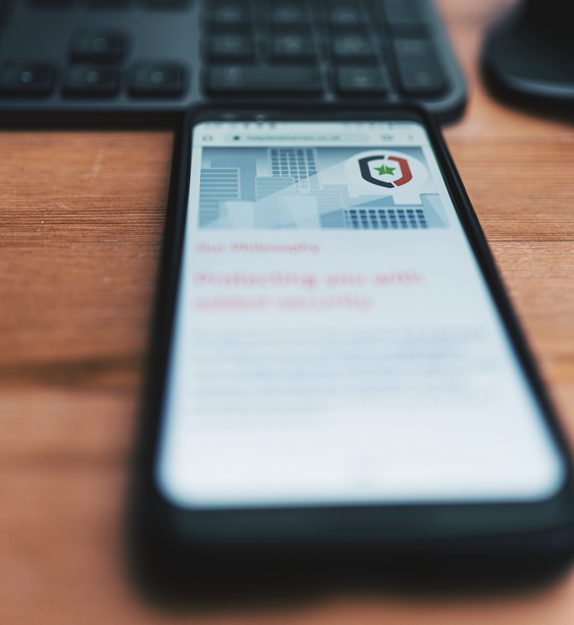Neu: Flexible Service-Kontingente für die Myra WAF. Jetzt mehr erfahren!
Home>
Privacy Shield
Auf einen
Blick
- 01. Privacy Shield: eine Definition
- 02. Wieso ist Privacy Shield nicht mit der DSGVO vereinbar?
- 03. Welche Strafen drohen Unternehmen bei Missachtung der neuen Rechtslage?
- 04. Wie können Datentransfers in die USA nach dem Aus von Privacy Shield rechtssicher erfolgen?
- 05. Wie wirkt sich die neue Rechtslage auf Cloud-Dienstleister aus?
- 06. An welchen Alternativen zu Privacy Shield arbeitet die EU-Kommission?
- 07. Privacy Shield: Das müssen Sie wissen
02
Wieso ist Privacy Shield nicht mit der DSGVO vereinbar?
Wie schon das Vorgänger-Abkommen Safe Harbor beschränkte sich auch Privacy Shield im Wesentlichen auf unternehmensseitige Selbstverpflichtungen, die den Schutz der übertragenen Daten garantieren sollten. Hierzu mussten die Firmen beim U. S. Department of Commerce gelistet sein. Einen konkreten Schutz sensibler Daten vor den Zugriffen von US-Behörden boten aber weder Safe Harbor noch Privacy Shield – auch an wirksamen Rechtsmitteln für Betroffene gegenüber behördlichen Zugriffen mangelte es.
Die DSGVO erfordert jedoch für außereuropäische Datentransfers die Herstellung eines angemessenen Schutzniveaus. Ausnahme bilden die sogenannten sicheren Drittstaaten (Andorra, Argentinien, Kanada (nur kommerzielle Organisationen), Färöer, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Neuseeland, Schweiz, Uruguay und Japan), in die eine Datenübermittlung ausdrücklich gestattet ist. Für sichere Drittländer liegt ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vor, der bestätigt, dass die nationalen Gesetze der jeweiligen Staaten ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten sicherstellen, das mit dem des EU-Rechts vergleichbar ist. Im Fall von Privacy Shield wurde diese Angemessenheitsentscheidung der EU-Kommission durch den EuGH für unwirksam erklärt. Dem Urteil des EuGH folgend steht daher fest, dass in den USA kein im Wesentlichen gleichwertiges Schutzniveau vorliegt. Folgende Gründe waren für den EuGH ausschlaggebend:
US-Recht verstößt gegen EU-Grundrechtecharta
Durch die Gesetzgebung (Section 702 FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) /E.O. 12333) der USA sind amerikanische Sicherheitsbehörden dazu berechtigt, bei Datentransfers aus der EU auf personenbezogene Daten zuzugreifen. Dieser Sachverhalt beschränkt Art. 7 und Art. 8 der EU-Grundrechtecharta unverhältnismäßig und verstößt ebenso gegen Art. 52 (1) S. 2 der EU-Grundrechtecharta (Rn. 184 f.), da:
einerseits der Zugriff auf personenbezogene Daten von Nicht-Amerikanern nicht beschränkt ist;
und andererseits, weil Nicht-Amerikanern keine durchsetzbaren Rechte gegen diese Zugriffe zur Verfügungen stehen.
Mangelnder Rechtsschutz
Gegen die Zugriffe der US-Sicherheitsbehörden besteht kein Rechtsschutz nach den Vorgaben der EU-Grundrechtecharta. So besteht gegen Zugriffe auf Basis der E.O. 12333 kein Rechtsschutz. Außerdem ist der in Privacy Shield festgeschriebene Ombudsmechanismus gegenüber US-Nachrichtendiensten unwirksam, da keine verbindlichen Entscheidungen daraus resultieren können.
04
Wie können Datentransfers in die USA nach dem Aus von Privacy Shield rechtssicher erfolgen?
Mit dem Wegfall von Privacy Shield war ein rechtskonformer Austausch von sensiblen Daten zwischen Europa und den USA prinzipiell über die Standardvertragsklauseln oder Binding Corporate Rules (BCR) möglich. Allerdings waren bei der Umsetzung einige Herausforderungen zu bewältigen. So betonte der EuGH in seinem Urteil, dass der Datenexporteur die Verantwortung zur Prüfung des Schutzniveaus trägt. Personenbezogene Daten müssen demnach in einem Drittland im Wesentlichen einen gleichwertigen Schutz wie unter der DSGVO genießen. Andernfalls seien Garantien über zusätzliche Sicherheitsmechanismen nach Art. 46 DSGVO zu implementieren.
Ein besonderes Hemmnis für DSGVO-konforme Standardvertragsklauseln mit US-Unternehmen stellt der im März 2018 unterzeichnete CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) dar. Das US-Gesetz verpflichtet amerikanische Internet-Firmen und IT-Dienstleister dazu, den US-Behörden auch dann Zugriff auf gespeicherte Daten zu gewähren, wenn die Speicherung nicht in den USA erfolgt. De facto sind damit international operierende US-Unternehmen, zur Herausgabe von Daten verpflichtet, wenn diese von US-Behörden angefragt werden.
Seit 10.07.2023 besteht durch das Trans-Atlantic Data Privacy Framework ein neuer Angemessenheitsbeschluss, der den rechtssicheren Datentransfer zwischen der EU und den USA ermöglicht.